
Pünktlich halb zehn geht es los: Birgit Müller, Projektmanagerin in der Softwareentwicklung von Wikimedia Deutschland stellt das „Projekt Technische Wünsche“ vor. Hauptthema des Projektes war die Kommunikation über und die Darstellung der Softwareentwicklungsprozesse. Die Ideen und Wünsche der Wikipedianer wurden mit Umfragen eingeholt. Das war eine sehr ertragreiche Methode: es kamen mehr als 200 Einträge zusammen. Der Input muss jedoch von erfahrenen Wikipedianern und Projektmanagern moderiert werden, damit alle Seiten die Problemstellungen verstehen. Workshops ermöglichen dann tiefer gehende Diskussionen.
Zum Abschluss ihres Vortrags gab Birgit eine interessante Zusammenfassung von Erkenntnissen, u.a.:
- Wikipedia ist ein kollaboratives Projekt – Austausch und transparente Prozesse ermöglichen erst eine Zusammenarbeit
- das Projektmanagement muss (Un)Möglichkeiten in der Softwareentwicklung verständlich kommunizieren
- Wikipedia ist ein Hobby – die Mitarbeit im Projekt sollte Spaß machen
Wir, die hauptamtlichen Mitarbeiter von Wikimedia Deutschland denken vielleicht zu wenig darüber nach, dass die Wikipedia für die Freiwilligen ein Hobby ist, das Spaß machen sollte. – Birgit Müller (WMDE)
Danach sitze ich ein wenig im Schatten von Sonnenschirmen im Vorhof des Museums und führe entspannte, angeregte und aufgeregte Gespräche.
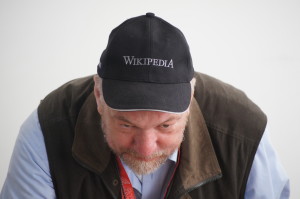
Halb elf fragen Austriantraveler und Regiomontanus, wie es nach dem erfolgreichen Projekt Denkmallisten in Österreich weiter gehen soll. Am Anfang des Projekts stand die Frage: W
Die Schwierigkeit mit dem öffentlichkeitswirksamen Wiki Loves Monuments ist, dass dort bevorzugt beliebte, leicht zugängliche Denkmäler fotografiert werden. 3.700 Fotos der Wiener Hofburg (ohne Museen) stehen 2.900 Denkmäler ohne Foto gegenüber. Es ist ziemlich klar, dass die letzten 10% der Denkmallisteneinträge nicht mehr mit Hilfe von über Wiki Loves Monuments herein kommenden Fotos bebildert werden.
Hauptfazit des österreichischen Denkmallisten-Projektes: Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt ist das Um und Auf.
Ich spreche die Referenten darauf an, ob sie nicht in sieben Wochen nach Schwerin zu WikiDACH kommen wollen, um mit ihren Erfolgen die dortigen Denkmalbehörden zu beeindrucken. Sie scheinen nicht abgeneigt.
Ich haste zur nächsten Session. Im großen Saal behaupten Gereon K., Renate, Martin Rulsch, Marcus Cyron und Veronika Krämer, „nach der Wikimania ist vor der Wikimania„. Gereon erzählt von dem Vortrag auf der Wikimania 2015 in Mexiko-Stadt, der ihn am meisten beeinflusst hat. Der Vortrag „Ebola Translations: How We Did it & How to Get Involved“ handelte davon, dass eine internationale Organisation ein milliardenschweres Informationsprogramm für afrikanische Länder gestartet hatte, die von Ebola betroffen waren. Bei einer Evaluation stellte die Organisation fest, dass sich 80% der Menschen vor Ort nicht bei ihrem Informationsprogramm, sondern in der Wikipedia über Ebola informierten. Daraufhin wandten sie sich an Wikimedia, um ein gemeinsames Projekt anzustoßen. Die Herausforderung war, dass in den betroffenen Ländern viele Einwohner die jeweiligen Kolonialsprachen Französisch oder Englisch gar nicht verstanden. Mit Hilfe von Translators without Borders wurden die betreffenden Artikel in 110 lokale Sprachen übersetzt. Am meisten war Gereon K. von dem Vorzeichenwechsel beeindruckt: Organisationen mit Weltbedeutung kommen inzwischen auf die Wikipedia-Community zu.

Danach erzählten Martin Rulsch über den Stipendienprozess und Marcus Cyron über Änderungen, die das Programmkomitee für die kommende Wikimania bei der Planung des Programms vornehmen will. Unter anderem mit Hilfe von anonymen Einreichungen von Vorträgen soll der Fokus auf den Austausch der Autoren gerichtet werden. Der Anteil der Beiträge von Funktionären und Angestellten der Wikimedia-Bewegung soll angemessen reduziert werden.
Pause. #wikicon15 pic.twitter.com/yGkQlZTjZx
— Sebastian Wallroth (@real68er) September 19, 2015
Mittagspause. Es gibt Kartoffelsuppe mit Würstchen und Kartoffelsuppe ohne Würstchen. Ich mache mit Renate einen Abstecher zum Dresdner Altmarkt. Es gibt Penna Arrabiata. Wir unterhalten uns über dies und das. Zum Beispiel über einen Workshop für Wikipedianer, die auf der Wikimania 2016 einen Vortrag halten möchten. Auf dem Workshop könnte man gemeinsam mit anderen die Idee zu dem Vortrag ausarbeiten und die Session vorbereiten. Zurück im Hygienemuseum entdecke ich, dass es nicht nur Filterkaffee aus der Pumpkanne, sondern auch richtigen Kaffee aus dem WMF-Automaten gibt. Ich unterhalte mich prächtig mit wechselnden Gesprächspartnern über dies und das. Zum Beispiel die persönliche Angefasstheit, wenn eine eigene Bearbeitung in der Wikipedia von jemandem zurückgesetzt wird.

In der nächsten von mir besuchten Session spricht Lukas Mezger über fehlende Strukturen für Opfer von Schmutzkampagnen, rechtlichen Auseinandersetzungen und Stalking im Wikipedia-Umfeld. Zunächst gibt er eine Übersicht über Konflikte innerhalb und außerhalb der Wikipedia. Als gut in der Wikipedia nannte er:
- Es gibt Regeln.
- Es gibt Prozesse.
- Es gibt ein Ende, indem man einfach den Browser zumacht.
Aber manche Konflikte verlassen die Wikipedia.
- Es gibt Schmutzkampagnen, die auf Konflikten innerhalb der Wikipedia beruhen und außerhalb ausgetragen werden, zum Beispiel in so genannten Hass-Blogs.
- Es gibt juristische Auseinandersetzungen.
- Es gibt das Nachstellen (das ist das deutsche Wort für Stalking).
Innerhalb der Wikipedia gibt es strenge Regeln. Zum Beispiel ist es in Diskussionen in der Wikipedia verboten, mit rechtlichen Konsequenzen zu drohen. So etwas kann zu einer Sperrung des Accounts führen. Was ist aber, wenn die Konflikte die Wikipedia verlassen? Lukas nennt Ratschläge:
- Ruhe bewahren.
- Einen Vertrauten hinzuziehen.
- Bei Stalking:
- Polizei anrufen. 112.
- Wenn man sich nicht traut oder die Polizei nicht angemessen reagiert: An das Community Advocacy Team der Wikimedia Foundation wenden. Die rufen sogar für Dich die Polizei an.
- Bei rechtlichen Auseinandersetzungen:
- Anwalt einschalten. Immer.
- Aber besonders, wenn Fristen gesetzt werden.
- Bei Schmutzkampagnen:
- Don’t feed the troll.
- Community Advocacy Team der Wikimedia Foundation einschalten.
Lukas weist darauf hin, dass es keine Anlaufstelle von Opfern von Konflikten gibt, die die Wikipedia verlassen. In der englischsprachigen Community gibt es bereits Diskussionen dazu.
In der nachfolgenden Diskussion wird angesprochen:
- Was ist mit falschen Anschuldigungen? Lukas meint, dass ein Zuviel an Solidarität derzeit nicht unser Problem sei.
- Wieso brauchen wir noch eine Anlaufstelle? Reichen die bestehenden nicht aus?
- Was ist mit dem Schaden, der realen Personen durch Einträge in der Wikipedia entsteht?
Es folgt ein kurzer Zwischenstopp in der Lounge, wo ich wieder interessante Gespräche führe. Zum Beispiel über die längste Denkmalliste in der deutschsprachigen Wikipedia (angeblich Berlin-Mitte).

In der folgenden Session stellen der Wikimedia Deutschland-Vorstand Christian Rickerts und der Wikimedia Deutschland-Präsidiumsvorsitzende Tim Moritz Hector in entspannter Atmosphäre kurz den Jahresplanungsprozess von Wikimedia Deutschland für 2016 vor. Die Partizipation der Mitglieder sollte besonders hoch ausfallen und nach Einschätzung von Tim Moritz ist das auch gelungen. Wieder eingeführt wurden in Zahlen ausgedrückte Ziele. Die Zahl von durch Maßnahmen des Vereins neu hinzuzugewinnende 20.000 Wikipedia-Autoren-Accounts führte zu Diskussionen, die eine Verlängerung der Session erforderte. Wie schon in Mexiko-Stadt wurde von den Veranstaltern der Session das Interesse der Leute außerhalb ihrer Kreise unterschätzt.
Zum Abend gab es ein leckeres Büfett; allein das Zucchini-Gemüse fand wenig Anklang.

Bei der Abendveranstaltung werden verdienten Wikipedianern Eulen verliehen. Bravo!
